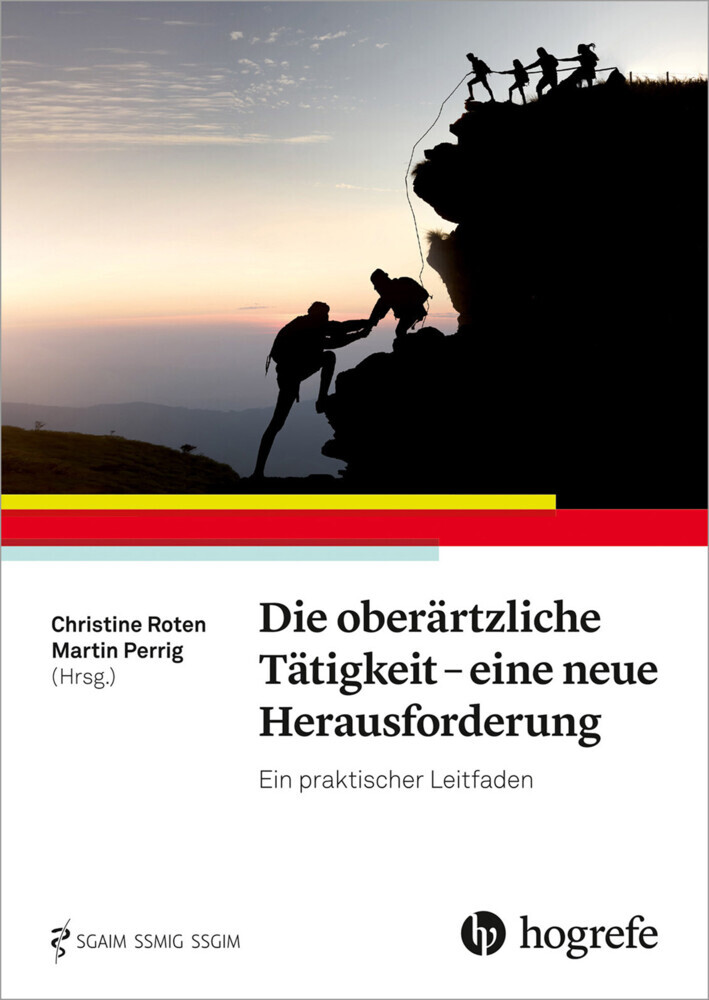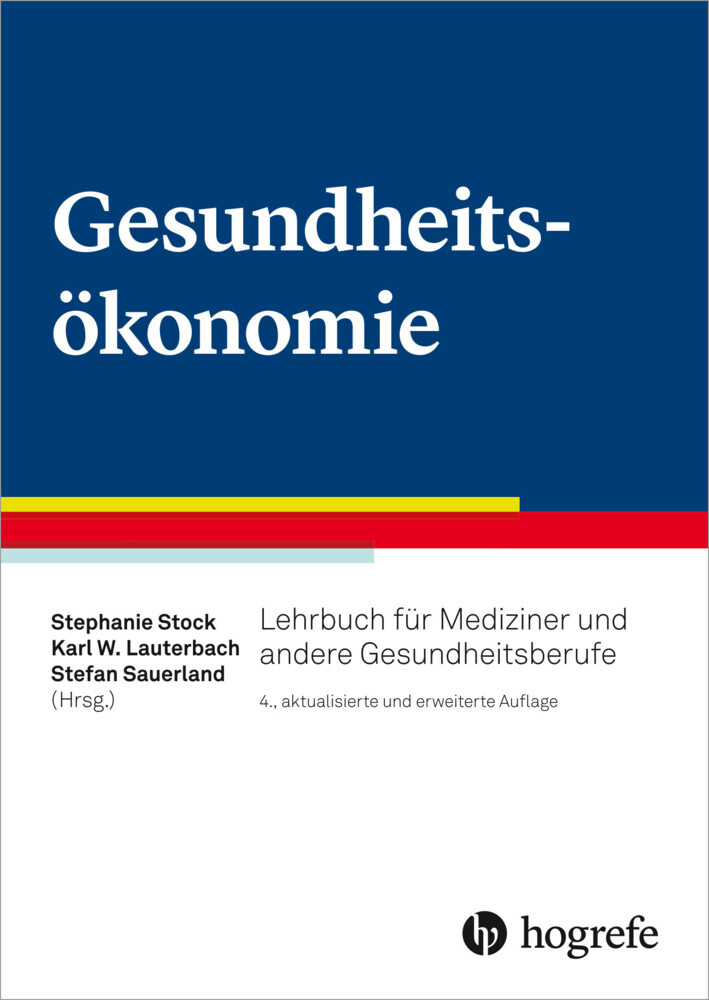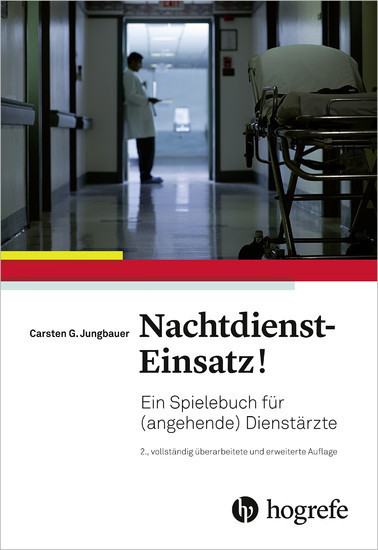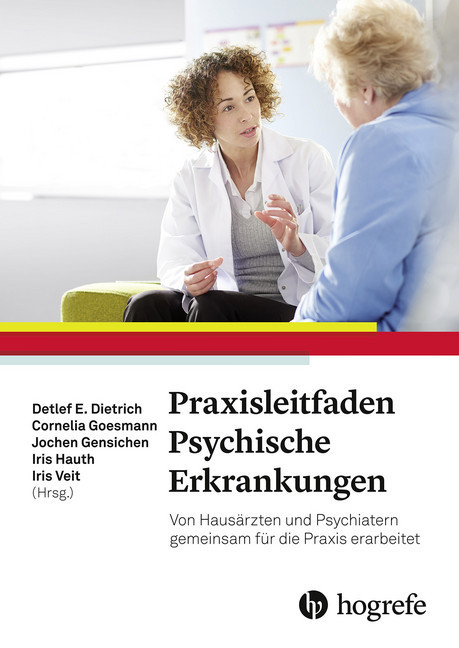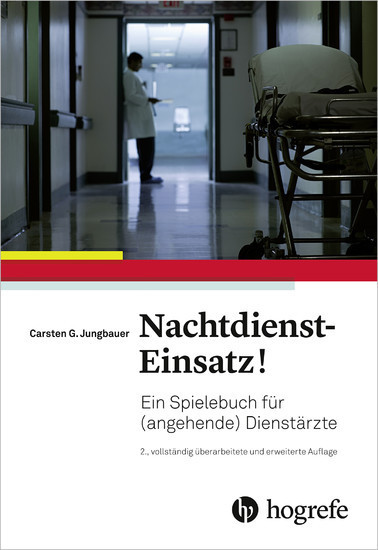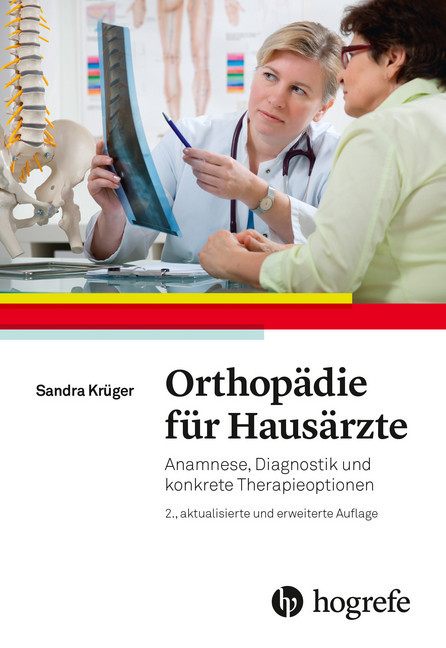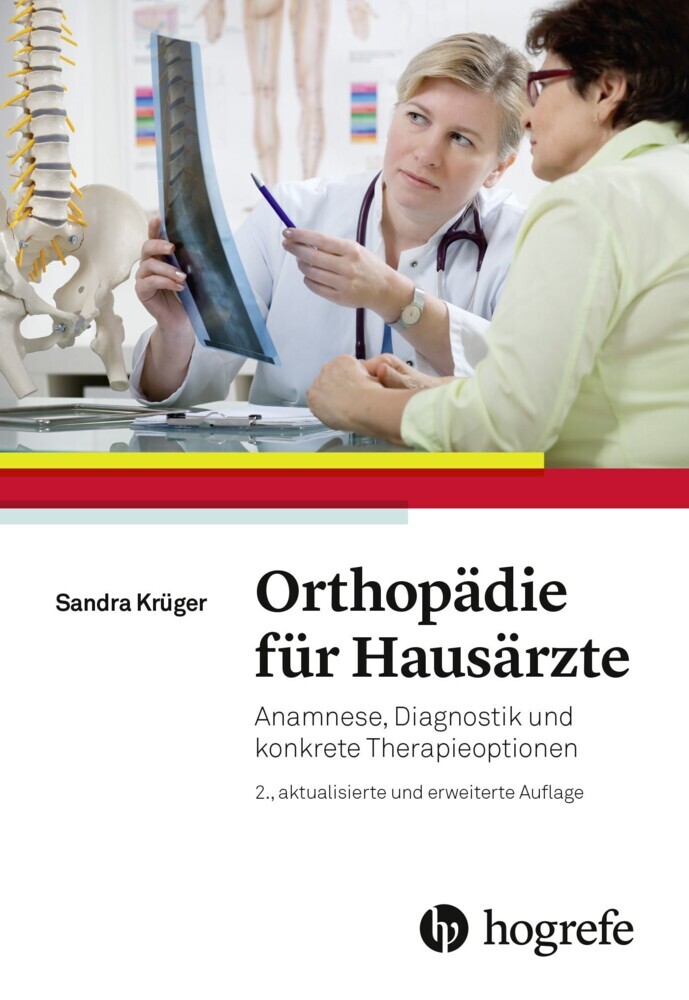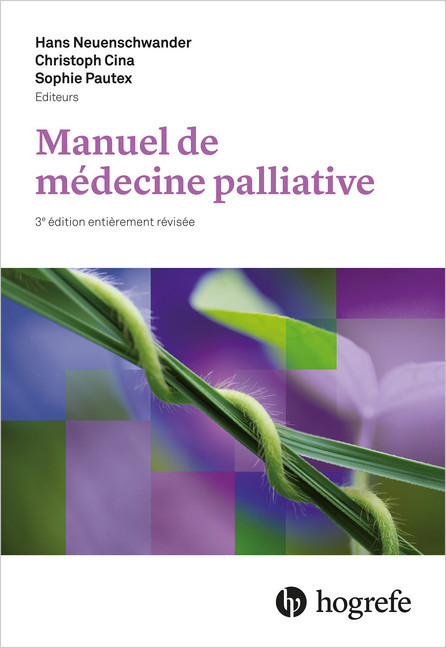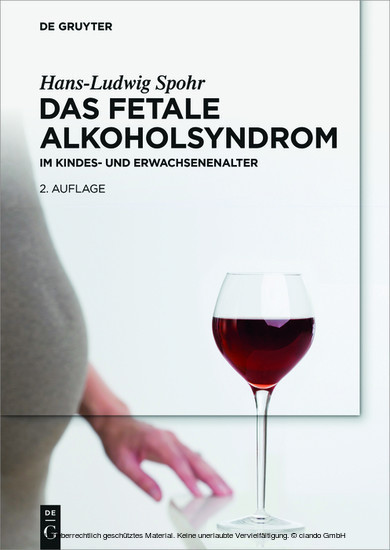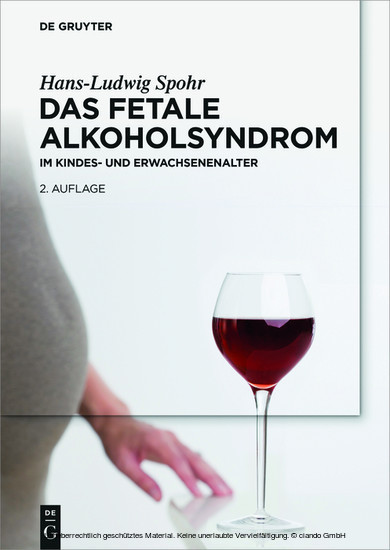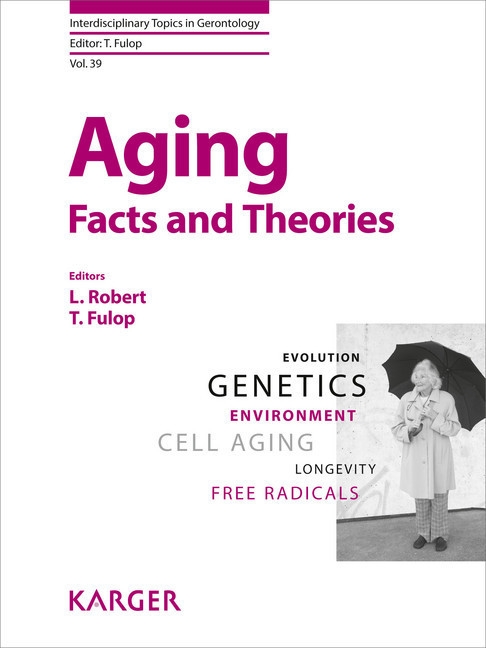Die oberärztliche Tätigkeit - eine neue Herausforderung
Ein praktischer Leitfaden
Kompakter Leitfaden für einen smarten Einstieg in die oberärztliche Tätigkeit in der Schweiz Für einen erfolgreichen Übergang von der internistischen Assistenzzeit zur oberärztlichen Tätigkeit ist es wichtig, möglichst früh die bevorstehenden Aufgaben zu kennen und sich die notwendigen Kompetenzen anzueignen. Denn neben der Abklärung und Therapie von internistischen Erkrankungen werden weitergehende Kompetenzen verlangt, wie die Betreuung von multimorbiden und schwerstkranken Patienten, Sicherheit und Souveränität in Notfallsituationen, die Anwendung evidenzbasierter Medizin sowie Sicherheit in anspruchsvollen kommunikativen Situationen im interdisziplinären Team oder mit Patienten und Angehörigen. Erfahrungen in ethisch-rechtlichen Fragestellungen und klinisches Teaching (Feedback, Clinical Reasoning) sind ebenso entscheidend wie ein souveräner Führungsstil, getragen durch Selbstreflexion und Selbstorganisation. Kenntnisse über das Schweizer Gesundheitswesen (Spitäler, Kosten, Modelle zu Finanzierung etc.) sind für diese Aufgaben ebenfalls gefragt. Dieser Leitfaden hat alle relevanten Herausforderungen für die künftige internistische oberärztliche Tätigkeit praxisrelevant und kompakt zusammengefasst, um den Einstieg in diese neue Funktion zu erleichtern. Zudem soll es Kliniken und Abteilungen erleichtern, geeignete Internist*innen zu finden und sie in ihrem Einstieg und ihrer Funktion gut zu unterstützen.
1;Inhaltsverzeichnis, Vorwort, Geleitwort;72;Vorbereitung auf die neue Position - warum ein Leitfaden für Oberärztinnen und Oberärzte?;213;1 Effektive patientenzentrierte Kommunikation;273.1;1.1 Kommunikation mit Patientinnen und Patienten;273.1.1;1.1.1 Patientenzentrierte Medizin;273.1.2;1.1.2 Shared Decision Making;283.2;1.2 Gesprächstechniken;303.2.1;1.2.1 Akronyme der Kommunikation;303.2.2;1.2.2 Informationsvermittlung;314;2 Multimorbidität im Spital;344.1;2.1 Definition von Multimorbidität;344.2;2.2 Bedeutung und Wichtigkeit;344.3;2.3 Grundsätze und Ziele bei der Betreuung von multimorbiden Patientinnen und Patienten;364.3.1;2.3.1 Beurteilung;364.3.2;2.3.2 Kommunikation;374.3.3;2.3.3 Massnahmen;374.4;2.4 Anpassung der Therapie: Polymorbidität und Polypharmazie;375;3 Herausforderung Akutsituation;395.1;3.1 Vorgehen in Notfallsituationen;395.2;3.2 Thoraxschmerzen;405.3;3.3 Dyspnoe;415.4;3.4 Akute Parese/Hemisymptomatik;435.5;3.5 Bewusstlosigkeit;435.6;3.6 Synkope;465.7;3.7 Delir/Verwirrtheit;485.8;3.8 Psychiatrische Notfälle;505.9;3.9 Sturz;515.10;3.10 Akutes Abdomen;515.11;3.11 Schock;535.12;3.12 Akute Kopfschmerzen;536;4 Infektiologische Prinzipien;576.1;4.1 Unterscheiden zwischen Inflammation und Infektion;576.2;4.2 Antibiotika rational und richtig einsetzen;586.3;4.3 Mikrobiologische Diagnostik und Befundinterpretation;616.4;4.4 Infektiologische Notfälle erkennen;626.4.1;4.4.1 Sepsis;626.4.2;4.4.2 Meningitis/Enzephalitis;626.4.3;4.4.3 Nekrotisierende Fasziitis;626.4.4;4.4.4 Endokarditis;626.4.5;4.4.5 Septische Arthritis;636.5;4.5 Nosokomiale Infektionen verhindern;636.6;4.6 Erkennen, wann man Spezialisten/Spezialistinnen involvieren sollte;636.7;4.7 Smarter Medicine;646.8;4.8 Spitalhygiene;646.9;4.9 Tipps;657;5 Medikamente sicher verordnen;677.1;5.1 Arzneimittelverordnung;677.1.1;5.1.1 Arzneimittelverordnung mit Diagnoseliste abgleichen;677.1.2;5.1.2 Arzneimittelverordnung mit Laborbefunden abgleichen;687.1.3;5.1.3 Arzneimittelverordnung auf "kritische" Wirkstoffe prüfen;697.2;5.2 Arzneimittelinteraktionen;717.3;5.3 Unerwünschte Arzneimittelwirkungen - Meldepflicht;727.3.1;5.3.1 Regionale Pharmakovigilanz-Zentren;757.4;5.4 Spezialthemen;757.4.1;5.4.1 Antikoagulanzien;757.4.2;5.4.2 Antidepressiva;777.4.3;5.4.3 Antipsychotika;798;6 Palliativsituationen;828.1;6.1 Prognoseeinschätzung;828.1.1;6.1.1 Kommunikation;838.2;6.2 Assessment nach SENS und Erstellen eines pragmatischen Behandlungsplans;838.2.1;6.2.1 SENS;848.2.2;6.2.2 Vom Assessment zum Sprechen über Reanimation und Entscheidungsfindung;858.3;6.3 Einschätzung der Urteilsfähigkeit;868.3.1;6.3.1 Dreistufiges Vorgehen;878.4;6.4 Weniger ist mehr: Medizinische Massnahmen in Abhängigkeit von der Prognose;888.4.1;6.4.1 4 Achsen - 3 Szenarios;888.5;6.5 Erkennen der Sterbephase und Kommunikation mit Patienten/-innen, Angehörigen und Team über das nahende Lebensende;898.5.1;6.5.1 5 Phasen der Betreuung in der Sterbephase;898.6;6.6 Umgang mit dem Wunsch nach assistiertem Suizid;918.6.1;6.6.1 Massnahmen;928.7;6.7 Medikamentöse Symptombehandlung in den letzten Lebenswochen;928.7.1;6.7.1 Analgetika;938.7.2;6.7.2 Dyspnoe;958.7.3;6.7.3 Nausea;958.8;6.8 Palliative Sedierung/gezielte Sedierung;969;7 Punktionen;989.1;7.1 Aszitespunktion;989.1.1;7.1.1 Indikationen;989.1.2;7.1.2 Kontraindikationen;989.1.3;7.1.3 Komplikationen;999.1.4;7.1.4 Aufklärung;999.1.5;7.1.5 Vorbereitung;999.1.6;7.1.6 Material;999.1.7;7.1.7 Durchführung;1009.1.8;7.1.8 Albuminsubstitution;1009.1.9;7.1.9 Interpretation Diagnostik - Tabelle 7-2;1019.2;7.2 Pleurapunktion;1019.2.1;7.2.1 Indikationen;1019.2.2;7.2.2 Kontraindikationen;1039.2.3;7.2.3 Komplikationen;1039.2.4;7.2.4 Aufklärung;1039.2.5;7.2.5 Vorbereitung;1039.2.6;7.2.6 Benötigtes Material;1049.2.7;7.2.7 Durchführung;1049.2.8;7.2.8 Nach der Punktion;1059.2.9;7.2.9 Interpretation Diagnostik;1059.3;7.3 Lumbalpunktion [1];1069.3.1;7.3.1 Indikationen;1079.3.2;7.3.2 K
| ISBN | 9783456961453 |
|---|---|
| Artikelnummer | 9783456961453 |
| Medientyp | E-Book - PDF |
| Copyrightjahr | 2021 |
| Verlag | Hogrefe AG |
| Umfang | 216 Seiten |
| Sprache | Deutsch |
| Kopierschutz | Digitales Wasserzeichen |